Artenlexikon
Brydewal

Artenlexikon:
Verbreitung
Der Brydewal – Pflug der Meere
Noch gilt der Brydewal nicht als gefährdet. Doch wie bei allen Großwalen gilt es auch hier, auf der Hut zu sein. Denn einige Staaten versuchen den kommerziellen Walfang, der seit den 80ern verboten ist, wieder zu etablieren.
Körperliche Merkmale
Wie der Seiwal gehört auch der Brydewal zu den Furchenwalen. Namensgebend für diese Walfamilie sind die Kehlfalten, mit denen sie ihr Maul vergrößern können, um mehr Nahrung aufzunehmen. Statt Zähnen verfügen die Wale über Barten, mit denen sie das Meerwasser filtern. Brydewale haben einen schlanken Körper mit einer kleinen 46 Zentimeter langen weit hinten sitzenden Rückenfinne. Ihr charakteristisches Merkmal sind drei vom Atemloch bis zur Spitze des Mauls parallel verlaufenden Längskiele auf der Kopfoberseite. Der Seiwal, der ansonsten nur schwer vom Brydewal zu unterscheiden ist, besitzt nur einen solchen Kiel. Ihre Lebensdauer ist nicht genau bekannt, aber es wurden schon Tiere mit einem geschätzten Alter von über 70 Jahren gefunden.
Lebensweise und Fortpflanzung
Brydewale sind im Alter von 15 bis 18 Jahren ausgewachsen. Sie leben zum Teil einzeln, zum Teil in Gruppen von zwei bis zehn Individuen – es wurden aber auch schon Gruppen von über 100 Tieren gesichtet. Ungewöhnlich für Furchenwale sind sie territorial und nähern sich manchmal auch Schiffen. Brydewale werden im Alter von sieben bis zehn Jahren geschlechtsreif. Die Paarungszeit ist meist im Winter, aber in einigen Regionen – wie in den Gewässern vor Südafrika – kann sie sich auf das ganze Jahr ausweiten. Brydewalkühe können alle zwei Jahre ein einzelnes Kalb zur Welt bringen. Bei der Geburt ist das Junge durchschnittlich über drei Meter groß und wiegt ca. 800 Kilogramm. Die Tragzeit beträgt zwölf Monate und die Kuh säugt ihr Kalb etwa sechs Monate lang, bevor es entwöhnt wird.
Ernährung
Der Brydewal besitzt 47 bis 70 der für Furchenwale charakteristischen Kehlfalten, die bei ihm vom Kinn bis zum Bauchnabel verlaufen. Wenn der Wal das Maul öffnet, blähen sich die Kehlfalten auf und er saugt Wasser ein. Es wird durch die Lücken zwischen den Barten gepresst. Der Brydewal hat ca. 250 bis 370 Barten, die grau mit weißem Rand gefärbt sind. Beim Herauspressen des Meerwassers schließt sich das Maul, die Kehlfalten ziehen sich zusammen und die Zunge des Wals drückt nach oben. Die Nahrung sich in den Barten und kann geschluckt werden. Der Brydewal hat verhältnismäßig grobe Barten, womit er neben Krill auch Fische frisst. Die erbeuteten Fische sind meist schwarmbildende Arten wie zum Beispiel Sardellen und Sardinen.
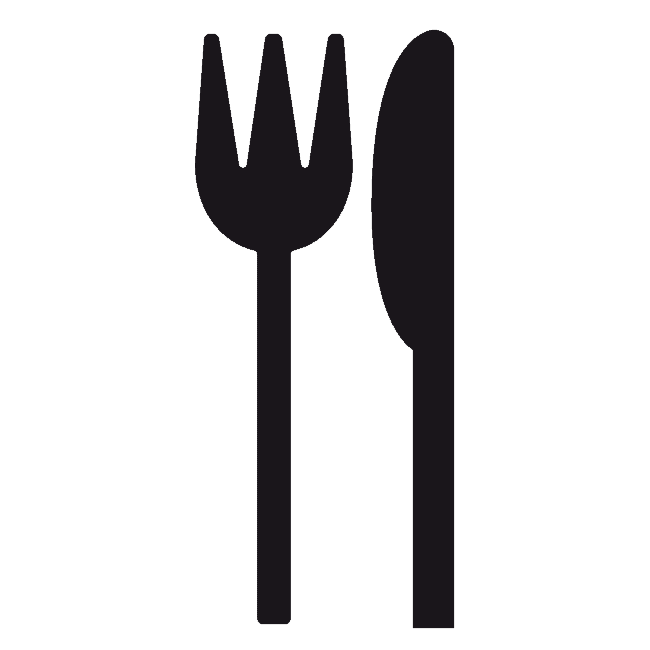
Brydewal und Mensch
Ursprünglich wurde der Brydewal nur im nördlichen Pazifik systematisch bejagt – das änderte sich in den 1970er Jahren mit dem Niedergang der meisten anderen Furchenwal-Bestände. Der von der internationalen Walfangkommission (IWC) im Jahr 1986 durch ein Moratorium verhängte Stopp des kommerziellen Walfanges brachte den Brydewalen keine Erholung.
Denn eine Ausnahme im Moratorium – der Walfang zu Forschungszwecken – wird oft als Vorwand genutzt, der wissenschaftliche Nutzen solcher Fänge ist jedoch längst widerlegt. Neben Brydewalen werden vor allem durch Japan aber auch Norwegen Mink-, Finn, Pott- und Seiwale gejagt, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als vor Erlass des Moratoriums. Nationen wie Japan und Island haben „wissenschaftliche“ Walfang-Programme gestartet und üben Druck auf den IWC aus. Japan ist 2019 jedoch aus der Internationalen Walfangkommission ausgetreten und hat daraufhin den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen, beschränkt diesen jedoch auf die japanischen Hoheitsgewässer. Es gilt zu hoffen, das die Nachfrage nach Walfleisch in Japan weiter sinkt und damit das Ende des Walfangs eingeläutet wird.
Der Wal in der Kulturgeschichte
Die Wahrnehmung des Wals hat sich in der Kulturgeschichte auf bemerkenswerte Weise gedreht: vom Meeresungeheuer und Feind zum friedlichen Riesen, der zum Symbolbild der menschlichen Zerstörungskraft gegenüber der Natur wird.
Schon in der Steinzeit waren Wale den Menschen bekannt, das zeigen etwa Felsmalereien, die in Norwegen gefunden wurden, genauso wie Werkzeuge, die aus Walknochen gefertigt wurden. Homer, Aristoteles und Plinius beschreiben die Tiere in der römischen und griechischen Antike, es besteht auch die Vermutung, dass das Meeresungeheuer, dem man Andromeda opfern wollte – bevor sie von Perseus gerettet wurde – ein Wal sein könnte. In moderner filmischer Interpretation (etwa in „Kampf der Titanen“ 2010) ist das Biest zum monströs überzeichneten Kraken geworden – wahrscheinlich ebenfalls aufgrund des Imagewandels des Wals.
Der Leviathan, ein Seeungeheuer der Bibel, ist so übermächtig, das nur Gott es bezwingen kann – in den Darstellungen trägt es Züge von Drache, Schlange, Krokodil und Wal. Von einem Wal verschluckt wird außerdem der Prophet Jona, der im Bauch des Tieres drei Tage und Nächte um Erlösung betet und schließlich ausgespien wird.
Die berühmteste literarische Darstellung vom Wal als Widersacher ist wahrscheinlich Moby Dick, wenn auch das Tier sich in erster Linie in Ahabs Kopf als Antagonist etabliert hat und nicht in der Realität der Handlung. In Melvilles Roman wird der Wal zum Sinnbild sinnloser Rachebesessenheit und fanatischer Jagd, die nur im Verderben enden kann.
Im 20. Jahrhundert ist der Wal als „sanfter Riese“ mit seinen ätherischen Gesängen das Sinnbild des Schadens, den der Mensch in der Natur anrichtet. In Walt Disneys „Free Willy“ ist der Wal durch Gefangenschaft gebrochen und wird schließlich durch ein Kind in die Freiheit entlassen, dass den Kreis durchbricht. Und nicht zuletzt: In „Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart“ ist das Gesang der Buckelwale die letzte Hoffnung der Menschheit auf Rettung. Ironischerweise wurden sie aber im 21. Jahrhundert ausgerottet, so dass die Crew aus dem 23. Jahrhundert zurückreisen muss, um den Planeten zu retten.
Projekte und Engagement des WWF
Der WWF ist weltweit in zahlreichen Projekten zum Schutz und zur Erforschung der Wale aktiv und hat für den Schutz der Wale bereits viel erreicht. Frühzeitig forderten wir das Ende des Walfangs und waren am Zustandekommen des internationalen Walfangmoratoriums 1986 beteiligt. Auch in der Errichtung des Walschutzgebietes in den Gewässern der Antarktis 1994 war der WWF maßgeblich involviert, 50 Millionen Quadratkilometer wurden als Walschutzgebiet ausgewiesen. Im nördlichen Mittelmeer wurde 1999 mit Hilfe des WWF ein 85.000 Quadratkilometer großes Schutzgebiet ausgewiesen, in welchem insgesamt 13 Walarten vorkommen.
Wir sind auch an der Ausweisung neuer Schutzgebiete beteiligt: Mit unseren Stellungnahmen, wissenschaftlichen Informationen und Interventionen konnten wir erreichen, dass Polen, Schweden und Dänemark verpflichtet wurden, weitere Gebiete zum Schutz des Schweinswals auszuweisen. In die Prozesse zur Ausweisung des ersten Schutzgebietes auf der Hohen See im Nordostatlantik sind wir ebenfalls maßgeblich eingebunden. Auch touristische Walbeobachtung wird vom WWF unterstützt und ist – zum Beispiel in Island – eine sich wirtschaftlich lohnende Alternative zur Waljagd.
Auch die internationale Gesetzeslage muss angepasst werden – wir arbeiten dementsprechend an nationalen und internationalen Konventionen und Vereinbarungen zum besseren Schutz der Wale. Außerdem setzt sich der WWF dafür ein, dass die Gefährdung der Wale durch Beifang der modernen Fischereiindustrie reduziert wird.
Wichtigste Themenfelder sind:
– Reduzierung des Beifangs oder das Verfangen von Walen in verlorengegangenen Fischernetzen (sogenannter Geisternetze)
– Reduzierung von Schiffskollisionen
– Klimaveränderungen und die Auswirkungen auf Wale
– Unterstützung von Walbeobachtung
– Walfang unter einer strengen Kontrolle der Internationalen Walfangkommission (IWC)
– Förderung von Walschutzgebieten
– Projekte zum Schutz bedrohter Arten und Populationen
Retten Sie bedrohte Tierarten mit einer
Wildlife-Patenschaft!
Gemeinsam können wir Wilderei, Artenhandel und Lebensraumverlust bekämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!





