Artenlexikon
Weißstorch

Artenlexikon:
Verbreitung
Der Weißstorch – Meister Adebar auf Reisen
Störche bringen zwar keine Kinder. Aber sie spielen als Zugvögel eine wichtige Rolle gleich in mehreren Ökosystemen. Doch auf dem langen Weg zwischen Sommer- und Winterquartier lauern Gefahren – die meisten davon von Menschen gemacht.
Körperliche Merkmale
Charakteristisch für den Weißstorch ist sein schwarz-weißes Gefieder und seine langen roten Beine und Schnabel. Die Flügelspannweite der imposanten Tiere beträgt rund zwei Meter, im Flug strecken sie den Hals elegant nach vorne. Weißstörche haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren. Der älteste gefundene Weißstorch war 35 Jahre alt.
Charakteristisch für den Weißstorch ist das Klappern, mit dem die Störche sich sowohl gegenseitig begrüßen als auch Feinde vom Nest fernhalten. Beim Klappern biegt der Storch Hals und Kopf nach hinten, bis der Scheitel den Rücken berührt. Häufig wird das Klappern von einer Art Fauchen begleitet.
Lebensweise und Fortpflanzung
Die Nester, auch Horste, der Weißstörche sind beeindruckend – sie können einen Durchmesser von bis zu zwei Metern und ein Gewicht von bis zu einer Tonne erreichen. Das liegt daran, dass die Tiere immer wieder zu ihren Nestern zurückkehren und diese ausbauen. Der Weißstorch brütet auf Hausdächern, Türmen, Strommasten oder Bäumen. Gern nimmt er auch künstliche Nestunterlagen wie Wagenräder an. In der Brutzeit, die von April bis Anfang August dauert, legt das Weibchen drei bis fünf Eier, die von beiden Partnern abwechselnd bebrütet werden. Erste Flugversuche des Nachwuchses erfolgen bereits nach sechs Wochen, nach ungefähr zwei Monaten verlassen die Jungvögel das Nest.
Der Weißstorch bevorzugt offene Landschaften, Feuchtgrünland, Flussniederungen und Auen mit regelmäßigen Überschwemmungen, sowie extensiv genutzte Wiesen und Weiden. In Südeuropa und Nordafrika kommt er auch in Trockengebieten vor.
Mitte bis Ende August starten die Tiere ihre Reise nach Afrika, wo sie südlich der Sahara überwintern. Je nach Startpunkt folgen sie dabei unterschiedlichen Routen. Dabei legen sie eine Entfernung von etwa 10.000 km zurück. Für diese Strecke benötigen sie ein bis anderthalb Monate. Der Rückflug beginnt in Afrika Mitte Februar, die Rückkehr erfolgt meist Anfang März bis Anfang April. Die Störche aus Österreich fliegen großteils über den östlichen Mittelmeerraum in den Osten und Südosten von Afrika. Nur die Vorarlberger Störche sind ‘Westzieher’ und fliegen über Gibraltar in den Westen Afrikas.
Ernährung
Weißstörche sind Fleischfresser. Sie erbeuten Kleinsäuger, Froschlurche, Eidechsen, Schlangen, Fische, große Insekten und ihre Larven, sowie Regenwürmer und in seltenen Fällen Eier und Vogeljunge von Bodenbrütern. Gelegentlich fressen sie auch Aas. Bei der Jagd schreiten die langbeinigen Vögel mit ihrem charakteristischen Staksen durch Wiesen und Feuchtbereiche und stoßen blitzartig mit dem Schnabel nach der Beute. Weißstörche sind außerdem Kulturfolger – haben sich also nicht nur an den Menschen angepasst, sondern nutzen seine Gegenwart: Nicht selten folgen sie landwirtschaftlichen Maschinen, um aufgescheuchte Tiere zu fressen. Größere Tiere werden zunächst mit dem Schnabel getötet und dann mit dem Kopf voran gefressen.
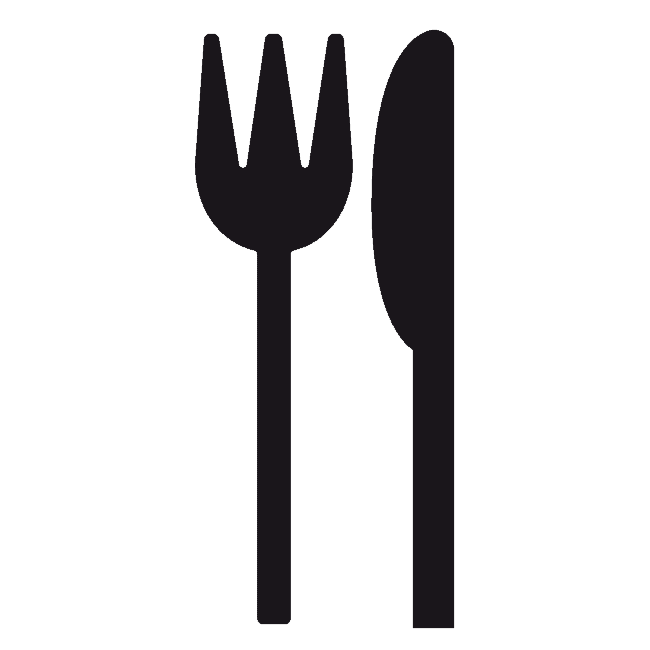
Audiobeschreibung: Weißstorch schnattert im Klapperduett.
Weißstorch und Mensch
Viele Feuchtgebiete, in denen der Weißstorch lebt und jagt, werden zunehmend entwässert und landwirtschaftlich genutzt. Das entzieht seiner Beute den Lebensraum und dem Storch folglich die Nahrung. Die Beutetiere, die noch vorhanden sind, sind oft durch Pestizide belastet, was natürlich auch den Räubern schadet und ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Auch finden die Vögel auf ihren Zugrouten immer weniger Rastplätze.
Was den Vögeln auf ihren Wanderungen außerdem oft gefährlich wird, sind Stromleitungen. Die Tiere sterben entweder an Stromstößen oder verletzen sich an Leitungen und Masten.
Der Weißstorch in der Kulturgeschichte
Am berühmtesten ist der Storch im europäischen Volksglauben wohl dafür, dass er Babys bringt. Der Sage nach finden die Vögel Kinder in Höhlen und Sümpfen und bringen sie dann zu kinderlosen Paaren. Immer wieder wurden in Gebieten mit vielen Storchenpaaren erhöhte Geburtenraten berechnet – obwohl kein Zusammenhang besteht. Tatsächlich gilt dieses Beispiel als Lehrbuchbeispiel für eine Scheinkorrelation.
Projekte und Engagement des WWF
In den Unteren Marchauen brüten ca. 40 Storchenpaare, die jährlich im Schnitt 80 bis 90 Jungvögel großziehen. Damit der Bestand dauerhaft geschützt ist, braucht es Raum – Lebensraum. Es ist also essentiell die Lebensräume der Störche zu schützen und zu erweitern. Deshalb engagieren wir uns global für die Bewahrung von Süßwasser-Feuchtgebieten: Naturzerstörende Eingriffe werden verhindert, geschädigte Biotope wiederhergestellt, Schutzgebiete ausgewiesen und eine naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft gefördert.
Im geschützten Auenreservat Marchegg erlebt Meister Adebar sehr günstige Lebensbedingungen. In den Auwiesen und Tümpeln finden die Störche reichlich Nahrung. Dazu zählen vor allem Regenwürme, Heuschrecken, Käfer, Mäuse und Frösche. Seit 2015 weiden hinter dem Marchegger Schloss wieder Rinder und Konik-Pferde. Diese halten die Vegetation niedrig und machen dem Storch die Jagd auf seine Beute leicht.
Retten Sie bedrohte Tierarten mit einer
Wildlife-Patenschaft!
Gemeinsam können wir Wilderei, Artenhandel und Lebensraumverlust bekämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!





