Artenlexikon
Wildschwein

Artenlexikon:
Verbreitung
Wildschweine – weltweit nützlich
20 Arten teilen sich den Namen Wildschwein. Und alle sind sie nützlich: sie wühlen Waldboden um, zerkleinern morsches Holz oder fressen Aas und kranke Tiere.
Körperliche Merkmale
Die Wildschweine sind eine große Gruppe – Merkmale wie Größe und Gewicht sind daher recht unterschiedlich. Das größte unter ihnen, das Riesenwaldschwein, erreicht eine Länge von bis zu 210 Zentimetern und ein Gewicht von über 270 Kilogramm. Das kleinste, das Zwergwildschwein, misst hingegen nur süße 65 Zentimeter und bringt rund neun Kilogramm auf die Waage. Das bei uns heimische Eurasische Wildschwein wird zwischen 90 und 180 Zentimeter lang und sein Gewicht variiert dabei zwischen 50 bis 200 Kilogramm.
Einige Merkmale haben die heute lebenden Wildschweine allerdings gemeinsam: Sie sind mittelgroße Paarhufer mit einem massigen Kopf und einem kurzen Hals. Ihr Fell ist rau und borstig und – je nach Art – grau, braun oder schwarz, mitunter gesprenkelt. Schweine haben relativ kleine Augen, eine recht bewegliche Schnauze und lange Ohren. Ihr Gehör- und Geruchssinn ist gut ausgebildet.
Charakteristisch sind die großen unteren Eckzähne, die seitlich aus der Schnauze herausragen, die sogenannten Hauer. Einige Arten haben deutlich ausgeprägte Gesichtswarzen, längliche Hautgebilde. Struktur und Funktion von Schnauze, Hauern und Gesichtswarzen sind auf die Nahrungsaufnahme und Kampf ausgerichtet. Der Schwanz der Schweine endet in einer Quaste. Er wird zum Insekten vertreiben und zum Ausdruck ihrer jeweiligen Stimmung genutzt.
Aufgrund ihrer weiten Verbreitung haben die verschiedenen Arten unterschiedliche, zum Teil bizarr anmutende Ausprägungen: das Pinselohrschwein beispielsweise ist orangebraun gefärbt und hat lange Haarbüschel an den Ohren. Die Männchen der asiatischen Hirscheber haben zusätzlich zu den unteren Hauern noch lange obere Eckzähne. Diese stoßen senkrecht nach oben durch die Rüsseldecke und krümmen sich nach hinten.
Lebensweise und Fortpflanzung
Je nach Lebensraum, Klima und Art unterscheiden sich Lebensweise und Fortpflanzung natürlich. Gemein ist den Wildschweinen, dass die Weibchen (Bachen) mit ihren Jungtieren in Gruppen, sogenannten Rotten zusammenleben, in denen festgelegte Rangordnungen bestehen. Wird die Rotte zu groß, teilt sie sich in kleinere „Familienverbände“ auf, wobei Wasserlöcher, Suhlen, Ruhe- und Futterplätze geteilt werden. Männchen, sogenannte Keiler, leben als Einzelgänger oder in „Junggesellengruppen“. Wildschweinarten sind territorial, wenn auch Reviergröße stark schwankt – zwischen weniger als einem und mehr als 20 Quadratkilometern.
Geschlechtsreife, Paarungszeit und Dauer der Trächtigkeit variieren zwischen den unterschiedlichen Arten. Die Keiler der altweltlichen Schweine sind bereits mit 18 Monaten geschlechtsreif, können sich jedoch erst mit etwa vier Jahren erfolgreich paaren, wenn sie vollkommen entwickelt sind. Die Pekaris sind etwa mit zwei Jahren fortpflanzungsfähig. Die Tragezeit dauert meist zwischen 100 und 175 Tagen. Ein Wurf besteht aus bis zu 12 Jungen. Nach drei Monaten werden die Frischlinge entwöhnt. Die meisten Schweine sind nachtaktiv, unsere heimischen und die Warzenschweine auch tag- und dämmerungsaktiv. In der Regel liegt die Lebenserwartung der verschiedenen Schweinearten bei 15 bis 20 Jahre, Hirscheber können sogar 24 Jahre alt werden.
Ernährung
Wildschweine sind Allesfresser: Sie ernähren sich von verschiedenen Pflanzen, Pilzen, Insektenlarven, kleinen Wirbeltieren, Regenwürmern, Schnecken und auch Aas. Manche Arten sind spezialisiert: Das Riesenwaldschwein ernährt sich von Gras und Laub auf immergrünen Lichtungen. Das afrikanische Warzenschwein ernährt sich fast ausschließlich von Gräsern und Gräserwurzeln, wobei es während der Regenzeit Grashalme bevorzugt und während der Trockenzeit vorrangig mit den Wurzeln vorlieb nimmt. Außergewöhnlich sind auch die Vorlieben des Chaco-Pekaris: es verzehrt hauptsächlich Kakteen. Auf der Suche nach Futter nehmen die Tiere sowohl die Rolle als Gesundheitspolizei wie auch als Förster und Gärtner ein: sie fressen Aas und verhindern so die Ausbreitung von Krankheiten, auf der Suche nach Gräsern und Kräutern wühlen sie den Boden um und zerkleinern morsches Holz.
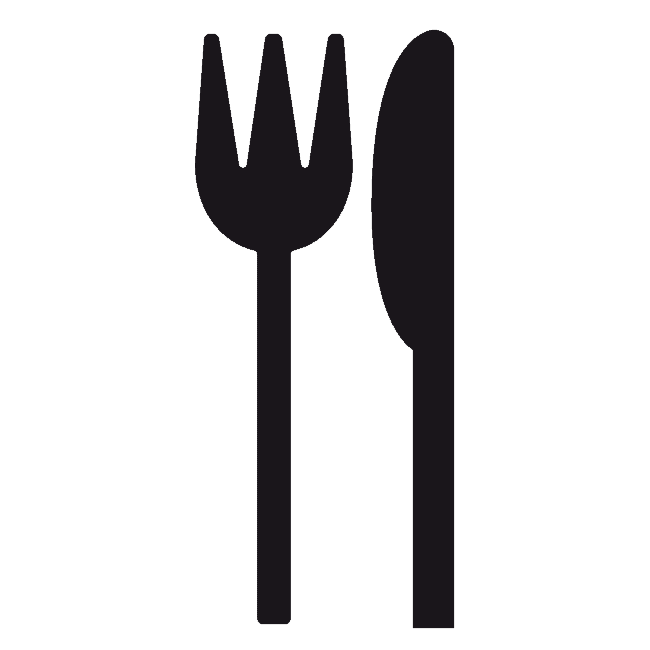
Audiobeschreibung: Wildschwein-Bache grunzt und schmatzt laut.
Wildschwein und Mensch
Als Vorfahr des Hausschweins und als wichtiges Jagdwild spielt das Wildschwein weltweit eine bedeutende Rolle in der Menschheitsgeschichte. Viele Arten, die heute bedroht sind oder deren Bestände abnehmen, werden durch die Jagd gefährdet. Einerseits, weil sie nach wie vor eine Nahrungsquelle darstellen, andererseits weil die Tiere auf Nahrungssuche immer wieder Schäden auf Feldern anrichten.
Aber auch die Ausbreitung des Menschen und damit einhergehend Lebensraumverlust machen den Tieren zu schaffen. Rodung, Trockenlegung von Marschländern und die Adaption für die Landwirtschaft entziehen den Schweinen die Lebensgrundlage.
Die Populationen von wilden Schweinen werden auch immer wieder stark durch Krankheiten dezimiert wie zum Beispiel durch Schweinepest, Schweine-Cholera, Maul- und Klauenseuche und Hautkrankheiten. Diese Krankheiten können unter anderem von Haustieren wie domestizierten Schweinen auf Wildpopulationen übertragen werden und dort einen Großteil der Individuen infizieren oder sogar töten. Ein weiteres Problem ist die genetische Vermischung von freilaufenden domestizierten Schweinen mit Tieren aus Wildpopulationen und die damit drohende Verdrängung der Wildart durch Hybrid-Nachkommen.
Wildschweine in der Kulturgeschichte
Besonders der Eber wird immer wieder mit Kraft und Mut assoziiert. In vielen Mythologien kommen Geschichten vor, in denen ein Held einen wilden Eber erlegen muss. Bekanntestes Beispiel ist wohl Herkules, der im Zuge seiner zwölf Aufgaben den Erymanthischen Eber einfangen muss. Im Nibelungenlied zeigt Siegfried seine Kampffähigkeit indem er einen wilden Eber mit dem Schwert erlegt. In der germanischen Edda müssen die Helden jeden Tag aufs neue einen wilden Eber erlegen, der immer wieder aufersteht.
In der modernen Popkultur bekannt ist das Wildschwein vor allem als Leibspeise des etwas rundlichen Galliers Obelix – eine kulinarische Leidenschaft, die er mit seinem gesamten Dorf teilt.
Projekte und Engagement des WWF
Der Schutz von Lebensräumen – von Wäldern, Marschen und Grasland über Savannen bis zu Sümpfen und Steppen – und ihrer Artenvielfalt ist ein vorrangiges Anliegen des WWF. Wildschweine sind häufig in denjenigen Gebieten anzutreffen, auf die wir unsere Schutzbemühungen richten. Eines der großen Ziele des WWF ist beispielsweise der Schutz der Lebensräume in den Terai-Duar Savannen und Grasländern in Südasien, in denen auch das Zwergwildschwein verbreitet ist.
Retten Sie bedrohte Tierarten mit einer
Wildlife-Patenschaft!
Gemeinsam können wir Wilderei, Artenhandel und Lebensraumverlust bekämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!









